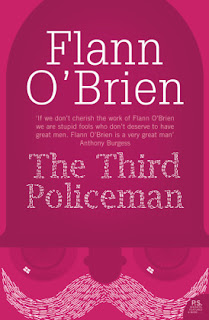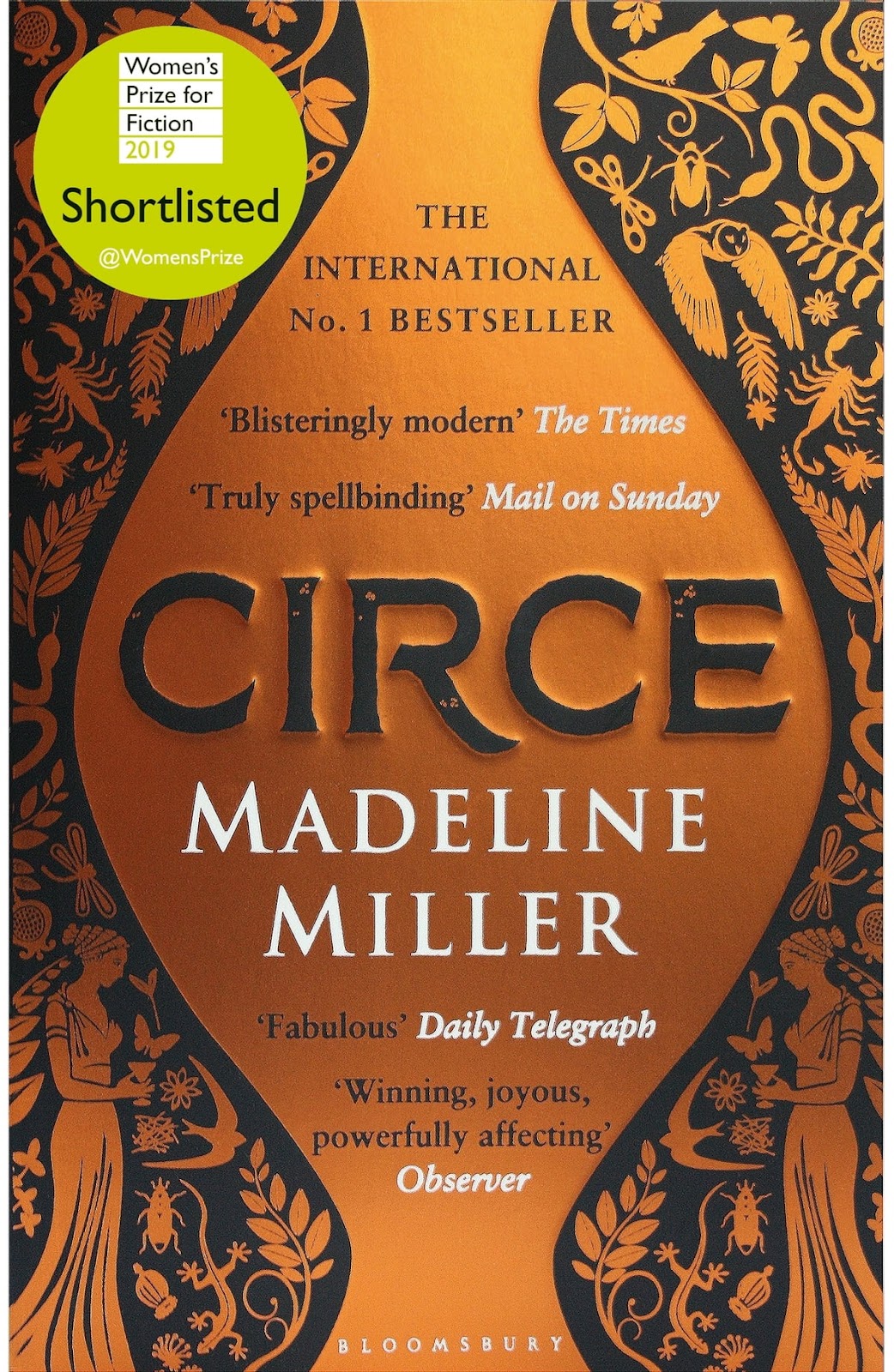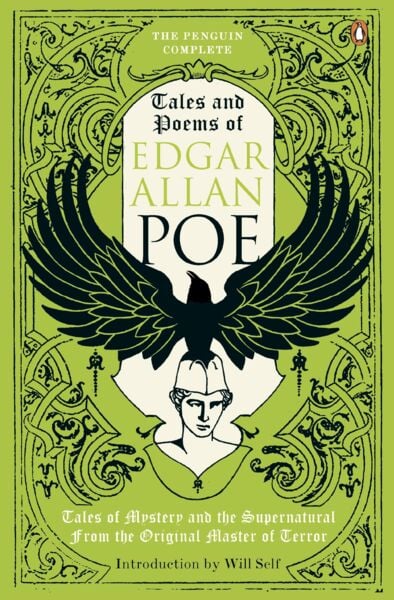Dostojewski – Schuld und Sühne
Ein mittelloser Student bringt eine alte Pfandleiherin und
deren Schwester im Affekt um, woraufhin er sich nach einigem Überlegen, von
Selbstvorwürfen und Sühneverlangen geplagt, der Polizei stellt. Dieser kurze
Satz könnte den Inhalt des wohl bekanntesten Roman des großen und vielleicht
bedeutendsten russischen Literaten, Fjodor Dostojewski, kurz und pointiert
zusammenfassen.
Das tut er aber nicht. Er gibt allerhöchstens den groben
Rahmen dieser meisterhaften Erzählung von menschlichen Abgründen und Verlangen,
sowie grundlegenden Fragen nach Schuld, sowie Gut und Böse, wieder.
Der russische Schriftsteller schildert vor dem Hintergrund
eines fiebrigen und lieblosen St. Petersburgs die Geschichte des verarmten und
einsamen Studenten Rodion Raskolnikow, der sich selbst für einen großen
Protagonisten der Weltgeschichte hält, welcher fälschlicherweise zur Armut
verurteilt ist, und der Gesellschaft und seinen Mitmenschen immer mehr abhanden
kommt. Auf seinen Streifzügen durch die Stadt begegnet Raskolnikow der gerissenen
Pfandleiherin Aljona Iwanowna. Da sie in seinem Weltbild zu unwerten Existenzen
zählt, überfällt er Frau Iwanowna, erschlägt sie und ihre Schwester kaltblütig
mit einem Beil und flieht.
In den folgenden Tagen irrt Raskolnikow fieberhaft umher, verfolgt
von Selbstvorwürfen und seinem eigenen Gewissen. Nachdem er der Polizei
mehrfach nur knapp entronnen ist, stellt er sich schließlich und offenbart
seine Tat.
Der Roman erkundet vielschichtig die menschliche Psyche und
stellt Fragen nach individueller Schuld und Vorwerfbarkeit. Wann ist eine
Handlung gut oder böse und vor allem: Kann sie einem Menschen vorgeworfen
werden? Dostojewski zeichnet das Bild eines Menschen, der mit seinem eigenen
ideellen Scheitern konfrontiert wird, dessen Weltbild zerbricht und Zuflucht in
seinem Gewissen und einer schonungslosen Sühne sucht.
Eine absolute Empfehlung für jeden Juristen, der hinter
einer Straftat nicht nur die Erfüllung von einigen Tatbestandsmerkmalen sieht,
sondern einen Menschen mit seiner eigenen Geschichte.
Fjodor
Dostojewski, Schuld und Sühne, 752 S., € 15
Ronen Steinke – Vor dem Gesetz sind nicht alle gleich
„Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich“- Dies proklamiert
zumindest der Art. 3 I des Deutschen Grundgesetz. Danach darf kein Mensch in
Deutschland vor dem Gesetz ohne sachlichen Grund ungleich behandelt werden.
Doch findet diese Verfassungsnorm Anwendung in den deutschen Gerichten, oder
ist sie bloß Verfassungspoesie?
Darf man Autor Ronen Steinke Glauben schenken, ist dieses Grundrecht nichts außer kitschiger Pathetik. Er ist der Meinung, das deutsche Recht begünstigte jene, die begütert sind, wohingegen es diejenigen benachteilige, die wenig oder nichts haben. Millionenschwere Wirtschaftsdelikte werden unter den Tisch gekehrt, während Schwarzfahren oder der Diebstahl eines Brotes streng und unnachgiebig bestraft würden.
Der deutsche Jurist stellt in einer packenden Reportage die
systematische Ungerechtigkeit in unserem Strafsystem dar. Steinke recherchiert
bei Staatsanwälten und Richtern, besucht Haftanstalten und spricht mit Anwälten
und Verurteilten.
Unnachgiebig zeichnet Steinke ein messerscharfes Bild von
einem angespannten Deutschland, in welchem sich soziale Ungleichheiten immer
weiter verschärfen. Arm und Reich driften stetig weiter auseinander. Und diese
Entwicklung spiegelt sich auch in dem Arbeits- und Strafverhalten der deutschen
Justiz wieder, welche die sozialen Gegensätze vergrößert.
Ronen Steinke stellt dringende Forderungen an ein
intoxikiertes und reformbedürftiges Strafsystem, die sich kein moderner
Rechtswissenschaftler entgehen lassen sollte -ob Strafverteidiger oder
Familienrechtler.
Ronen
Steinke, Vor dem Gesetz sind nicht alle gleich, 272 S., € 20
Friedrich Dürrenmatt – Der Richter und sein Henker
Stellen Sie sich vor Sie sind Kriminalkommissar und Ihr
Mitarbeiter wird umgebracht. Zur Aufklärung des Falls setzen Sie auf Ihren
besten Kollegen – der aber eigentlich der Mörder ist.
Das ist das Szenario, in welchem der Meister der kurzen und
pointierten Sätze, Friedrich Dürrenmatt, einen abstrusen Kriminalfall voller
Finesse schildert, welcher die eigen Moralvorstellungen und Überlegungen zu
einer gerechten Strafe herausfordert.
Kriminalkommissar Hans Bärlach ist krank, als sein
eigentlich bester Mitarbeiter, Ulrich Schmied, kaltblütig erschossen wird. Er
setzt seinen kaltschnäuzigen Assistenten Tschanz auf die Fährte des Mörders,
wobei Bärlach nicht weiß, dass Tschanz der Übeltäter ist. Vermeintlich zufällig
lenkt der Mörder den Verdacht und die Ermittlungen auf den kriminellen
Lobbyisten Gastmann, welcher der langjährige Rivale von dem Oberkommissar ist.
Im Zentrum der Handlung steht die Wette zwischen Kommissar
Bärlach und dem Verbrecher Gastmann, der Bärlach bisher immer durchs Netz
gegangen ist. Gastmann ist der Meinung, er würde niemals von Bärlach geschnappt
werden und sich in Sicherheit wähnt.
Der Richter nimmt hier nicht die Rolle eines fairen und
gerechten Juristen ein, welcher auf die reine Verurteilung des Täters abzielt.
Viel mehr stellt Dürrenmatt Fragen nach Moral und den Grenzen zwischen Gut und
Böse bei einer Tat. – Ein spannendender Kriminalroman mit Tiefgang, der wohl
jeden Juristen packen wird.
Friedrich
Dürrenmatt, Der Richter und sein Henker, 192 S., € 10
Sandra Frimmel – Kunst vor Gericht
Egal ob während der Schulzeit im Politikunterricht, bei der
Strafrechtsvorlesung im Hörsaal, oder bei der finalen Arbeit als
Strafverteidiger; der Begriff des Strafrechts wird fast immer nur mit Mord,
Körperverletzung oder Diebstahl in Verbindung gebracht und behandelt.
Fast keiner spricht in diesem Zusammenhang von Kunst, zumal Kunst ja auch nicht strafbar sein kann – oder?
Oh doch, spätestens seit dem 21. Jahrhundert ist die
strafrechtliche Verfolgung von Kunst keine Seltenheit mehr. Ob Gerichtsprozesse
wegen Kunstfälschung oder Uhrheberecht, die Kunst ist im Strafrecht angekommen.
Dabei wird im Falle eines Gerichtsprozess die Öffentlichkeit
zumeist nur über das endgültige Urteil informiert, und nicht über die dem
Urteil zugrunde liegenden ästhetischen Debatten.
Das findet Autorin Sandra Frimmel schade, denn eben diese
Debatten seien es doch, die Aufschluss darüber gäben, über welches
Kunstverständnis eine Gesellschaft verfügt und auf welche Weise sie diese in
einem juristischen Rahmen verhandelt.
Frimmels Buch versammelt Materialien über Gerichtsverfahren,
die seit Ende des 19. Jahrhunderts gegen Künstler und Kuratoren geführt worden
sind und geführt werden. Die Prozesse
verdeutlichen einen Wandel der juristischen Bewertung von Kunst und den
tiefgehenden Wandel eines gesellschaftlichen Kunstverständnisses.
Frimmels Fokus liegt hierbei auf der Frage, wie eigentlich
vor Gericht über Kunst debattiert wird.
Diese ästhetische Debatte ist wirklich ein Muss für jeden
kunstinteressierten Rechtswissenschaftler.
Sandra
Frimmel, Kunst vor Gericht, 525 S., € 48
Hans Litten – Anwalt gegen Hitler
Deutschland 1933 bis 1945 – Ein Land fest in den Krallen des
vielleicht grausamsten Menschen der jemals gelebt hat. Gleichschaltung aller
politischen, gesellschaftlichen und juristischen Institutionen. Hitler hat es
geschafft jeglichen Widerstand und Ungehorsam in seinem Keim zu ersticken. Fast
jeden zumindest.
Einer der wenigen, welcher sich Hitler bereitwillig in den
Weg stellte war Hans Litten. Der deutsche Rechtsanwalt stellte im Jahre 1931
den „Schriftsteller“ Adolf Hitler als Zeuge für die eklatante
Gewaltbereitschaft von SA und NSDAP vor dem Berliner Kriminalgericht zur Rede.
In einem spektakulären Gerichtsprozess versuchte Litten aufzuzeigen, dass der Terror der SA und NSADP als planmäßige Taktik der nationalsozialistischen Führung dazu benutzt wurde, die demokratischen Strukturen der Weimarer Republik zu zerstören.
Litten verteidigte als „Anwalt des Proletariats“ in
zahlreichen Prozessen straffällige Jugendliche, trat als Nebenkläger für die
von faschistischen Schlägertrupps attackierten Kommunisten auf und legte sich
mit der rechtslastigen Justiz der Weimarer Republik an.
Der mutige Anwalt, dessen Lebensgeschichte in Ostpreußen mit
der jüdischen Jugendbewegung begann und schlussendlich im KZ endete, ist heute,
weit über Deutschland hinaus ein politisch bekannter Anwalt, der sich
kompromisslos und unbeugsam für seine Mandanten eingesetzt hat.
Die Biografie von Hans Litten ist ein kleiner Lichtblick in
einer sonst so dunkeldüsteren Zeit der deutschen Justiz-Geschichte.
Hans
Litten, Anwalt gegen Hitler, 384 S., € 28
Sebastian Schneider